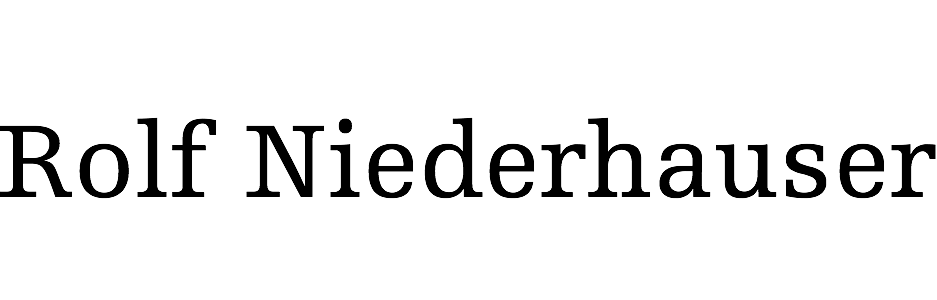Anlässlich der Vernissage einer Ausstellung der Basler Künstlerin Stephanie Grob im Kantonsspital Olten unter dem Titel: »…DIESES LEBEN…« am 22. September 2015 versuchte Rolf Niederhauser die Besucherinnen und Besucher in ein Zwiegespräch zwischen Malerei und Literatur zu entführen, ein Ping-Pong zwischen Bild und Sprache, dessen Verlauf Sie hier mitverfolgen können:
Meine Damen und Herren,
hoffentlich gehören Sie nicht zu den Menschen, die mit Schweissausbrüchen, Atemnot oder auch nur mit einer stillen Beklemmung ringen müssen, wenn Sie ein Spital betreten. Falls doch, freut es uns allerdings umso mehr, dass Sie hier sind, denn Frau von Arx, Frau Meier und Herr Eisner organisieren diese Ausstellungsreihe im Kantonsspital sicher nicht zuletzt mit dem Bedürfnis, durch beschauliches Gestalten dieser Räume Schwellenangst und Unbehagen zu mindern. Auch wer nicht an Krankenhausphobie leidet, wird deren Symptome ja nicht ganz unverständlich finden: Spitäler haben etwas Unheimliches, da wird gestochen und gespritzt, sondiert, geröntgt, geschnitten, gesägt, amputiert oder implantiert, und obschon das alles einem guten Zweck dient, geht es ans Lebendige, kein Zweifel, der Spitalbetrieb geht unter die Haut.
Ja, und Bilder gehen auch unter die Haut, könnte ich jetzt sagen, um Ort und Gegenstand unserer Zusammenkunft elegant zu verbinden. Bis zu einem gewissen Grad dürfte ich dabei sicher auf ihre Zustimmung hoffen. Aber die Parallele wäre zu billig, wenn nicht gar ein wenig respektlos: schliesslich ist es nicht egal, ob etwas nur bildlich gesprochen unter die Haut geht oder eben buchstäblich – und dies, gerade weil Ärzte, im Gegensatz etwa zu Schriftstellern, nicht mit Buchstaben operieren.
Hinzu kommt, dass die umgekehrte Behauptung vielleicht sogar plausibler erscheint. Denn von einem konventionellen Standpunkt aus gesehen, sind Bilder in erster Linie etwas Beschauliches. Und das gilt sogar für die Malerei von Stephanie Grob, obschon Beschaulichkeit im landläufigen Sinn gewiss nicht das Erste ist, was sie anstrebt. Auf diesem landläufigen Sinn brauchen wir allerdings nicht zu beharren. Beschaulich ist, was zum Beschauen einlädt. Oder auffordert? Nein, die Art, wie etwa der Arzt aufgefordert ist, eine Wunde zu beschauen, geht über das Beschauliche entschieden hinaus. Eine Aufforderung erwartet ein Urteil. Und auch wenn von den hier gezeigten Bildern eine solche Aufforderung ausgehen mag, sind sie doch beschaulich in dem Sinn, dass sie uns die Freiheit lassen, damit zu machen, was uns gefällt oder entspricht. Das Beschauliche erlaubt uns, diskret Abstand zu wahren.
Was es mit diesem »Wahren« für eine Bewandtnis hat, werden wir noch sehen. Jedenfalls geht das Beschauliche gerade nicht unter die Haut, oder nur in dem Mass, in dem wir uns darauf einlassen. Was nicht ausschliesst, dass wir aus intimer Distanz umso tiefer in das eindringen können, was sich da zeigt. Und dass es Stephanie Grob auf eben diese Tiefe abgesehen hat, das ist ihren Bildern auf den ersten Blick anzusehen. Ja, mir scheint sogar, wie sehr sie sich in Motiv und Technik unterscheiden, gemeinsam ist ihnen, dass sie Räume eröffnen, durchzogen von Farben, Formen, Figuren, die in ihrer schemenhaften Vielgestaltigkeit alle nur dazu da sind, auf eben diesen Raum zu verweisen, den sie einnehmen und ausfüllen.
Aber: Raum – was ist das eigentlich? Eine abgründige Frage. Nehmen Sie irgendeinen Gegenstand im Raum, zum Beispiel den Stuhl auf dem Sie sitzen, und denken Sie sich einmal alles weg, was wir sinnlich davon wahrnehmen können. Stellen Sie sich vor, die Lehne gibt kein Geräusch von sich, wenn Sie drauf klopfen, und das Holz keinen Geruch. Auch die Farbe denken wir uns weg, ebenso jede Oberfläche, in der das Licht sich spiegelt. Damit ist er vollkommen durchsichtig geworden, und wenn Sie danach fassen, empfinden Sie keine Härte, keinen Widerstand, kurz: der Stuhl ist unter der Hand und vor Ihren Augen verschwunden. Was bleibt? Nun ja, der Raum, den er eingenommen und ausgefüllt hat in den Umrissen seiner Gestalt. Die Gestalt gehört zum Stuhl nicht weniger als seine Härte, Farbe, und so weiter, aber als solche, als leere, können wir sie nicht wahrnehmen. Den Raum als solchen können wir nicht wahrnehmen, weil er das Nichts ist, in dem die Gegenstände Platz nehmen.
Eben dadurch ist er aber die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt Gegenstände geben kann – Dinge, Gestalten, Körper, Felder – deren reales Vorhandensein wir erfahren und überprüfen können. Denn eine Sache erfahren, heisst etwas ins Spiel bringen, das ausserhalb der Einbildung liegt. Und eben dieses Ausserhalb setzt Raum voraus.
Das heisst allerdings, dass wir zunächst und zumeist in der Einbildung leben; pathologisch gesprochen, in Halluzinationen, malerisch ausgedrückt: in Bildern. Nur konkrete Erfahrungen lassen uns die Einbildung als solche erkennen. Raum ist somit unsere Fähigkeit, zu den Bildern auf Distanz zu gehen. Und dass er eben deshalb in jeder Erfahrung vorausgesetzt ist, darf man keinesfalls so verstehen, als sei diese Voraussetzung uns Menschen angeboren, also immer und überall zum Vornherein gegeben. Zahllose Schwierigkeiten des Alltags zeugen davon, dass wir alle zunächst und zumeist in Halluzinationen leben.
Und eigentlich wissen wir das spätestens seit Immanuel Kant, also seit über 200 Jahren. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass etwa die Naturwissenschaft dieser Einsicht hinreichend Rechnung trägt. Dabei ist die Naturwissenschaft entscheidend, auch für die Medizin – erst recht, seit nicht nur die Chirurgie, sondern auch die Diagnostik ohne High-Tech kaum mehr auskommt. Und Raum als Fähigkeit, zu den Bildern auf Distanz zu gehen: das gilt auch für die Bilder, die uns die Naturwissenschaft liefert, etwa durch die »bildgebenden Verfahren« der Hirnforschung, die zeigen will, wie Wahrnehmung, Denken und Erfahrung »objektiv« funktionieren. Die Gefahr, dass wir wissenschaftliche Objektivität verabsolutieren, hat mit der Verabsolutierung des Raums zu tun, die allerdings sehr verständlich ist.
Weil Raum sich nicht erfahren lässt, hat er selber etwas Imaginäres. Er ist nicht viel mehr als eine Idee – oder genauer: er ist die Idee der Nicht-Idee, die Kant die »reine Anschauung« nennt. Warum haben wir trotzdem das Gefühl, wir könnten den Raum, der uns umgibt, doch auf Schritt und Tritt erleben, ihn sozusagen mit Händen greifen? Die Antwort liegt auf der Hand: weil wir die Räumlichkeit am eigenen Leib erfahren. Dass Körperlichkeit ohne Raum gar nicht denkbar ist, verführt uns dazu, die Erfahrung des eigenen Körpers für die Erfahrung des Raums zu halten, den er einnimmt, und diesen als unser »Innen« zu empfinden. Die Erfahrung des Körpers, den wir haben, verführt uns zur Vorstellung, dieser Körper zu sein. Wir identifizieren uns mit ihm aufgrund des Eindrucks, aus diesem Körper in die Welt hinaus zu blicken.
Dabei ist auch »der Körper« zunächst nur eine Idee, eine Vorstellung, ein Bild. Und so wird der eigene Körper in Fitness-Studios, Schönheits-Salons, Tattoo-Boutiquen und Yoga-Zentren als Produkt der Einbildungskraft geformt – bis uns zum Beispiel ein Spitalbesuch daran erinnert, dass wir kein Design-Gegenstand sind, sondern etwas Lebendiges, das heisst letztlich: etwas Unfassliches. Denn auch wenn die fünf Sinne, mit denen der Körper mich ausstattet, mir fortwährend alles Mögliche präsentieren, was das Leben mir abverlangt, zumutet oder bietet: ob es wirklich das ist, was ich mir jeweils einbilde, steht auf einem anderen Blatt.
Damit sehe ich mich einem Leben ausgesetzt, das durch Ungewissheit geprägt ist. Und dieses Leben – so meint es auch der Titel unserer Ausstellung: …dieses Leben… – ist der Inbegriff des Unfassbaren: das Unfassbare des Unfassbaren überhaupt. Denn nichts ist ja weniger selbstverständlich, als dass wir imstand sind, Unfassbares als solches zu erfassen. Oder Unerkennbares als solches zu erkennen.
Eben dadurch aber wird der Raum, den der eigene Körper einnimmt, zum Abgrund eines dunklen Innen, das uns mit Ungewissheit konfrontiert, aber auch mit Möglichkeiten, indem es uns erlaubt, Abstand zu wahren, die Dinge von verschiedenen Seiten zu sehen. Das Wahren des Abstands ist die Voraussetzung dafür, Wahres von Unwahrem, Mögliches von Wirklichem und dieses von Unwirklichem zu unterscheiden. Und so wird die Idee des Raums zu einer Haltung: Raum ist das, was wir einnehmen und aushalten müssen und können genau in dem Mass, in dem wir die Kraft haben, Erfahrungen zu machen.
Damit scheint mir nun aber nicht nur das Wesen des Raums, sondern auch das der Malerei von Stephanie Grob erschlossen. Sie ist zwar nicht die einzige, die das Wunder vollbringt, aus der Oberfläche einer Leinwand vor unseren Augen einen Raum hervorzuzaubern, einen vollkommen imaginären Raum. Im Gegensatz zu vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen füllt sie diesen aber nicht so sehr mit den Gestalten ihrer Imagination, vielmehr scheint sie ihn durch körperliche Empfindungen und Regungen ergründen zu wollen.
Wie die schlanke Springerin, der sie eine ganze Serie von Bildern gewidmet hat, taucht sie in diesen Raum ein, um seine Weite zu erkunden, seine Tiefe zu durchdringen, durchaus im Wissen, dass es ihre eigene ist. Das können Sie etwa daraus ersehen, dass der Körper der Springerin immer in der Farbe des Mediums gehalten ist, dem sie sich hingibt – oder im Sprung sogleich hingeben wird – so wie sich die Künstlerin den Bewegungen ihrer arbeitenden Hände hingibt, während sie mit wachen Sinnen die Erfahrung einer traumhaften Körperlichkeit festhält, in deren Umrissen sich der leere Raum als Wagnis abzeichnet: im Wagnis des Sprungs.
Was Stephanie Grob an einem solchen Motiv zum Malen bewegt, ist das Bestreben, sinnliche Wahrnehmungen nicht nur bildlich, sondern physisch umzusetzen, ihnen Raum zu verschaffen, der aber imaginär bleiben muss. Denn was in solchen Räumen zum Ausdruck kommt, ist ein Sensorium, das im Alltag brachliegt. So können wir zumindest das Motiv deuten, dass im Zentrum einer anderen Serie von ihr steht: eine Pflanze, die sie vorwiegend auf Brachen, also zeitweilig ungenutzten Feldern entdeckt hat. Deren Name, Dipsacus fullonium, erzählt davon, dass ihre Blätter so fest verwachsen, dass die Pflanze darin Regenwasser sammeln, also Gefässe bilden kann, mit deren Hilfe sie ihren Durst – griechisch »dipsa« – löscht. Auf deutsch wird sie die Wilde Karde, aber auch Walker- oder Weberdistel genannt, weil die getrockneten Blütenköpfe zum Walken, Kämmen und Bürsten von frischem Gewebe verwendet wurden. Und wenn es stimmt, was ich darin sehe, hat die Künstlerin in diesem Motiv ein Bild für die Motivation ihrer Malerei überhaupt gefunden, so wie Diego Velázquez in seinen Hoffräulein ein Motiv dafür fand, die Kunst der Repräsentation als solche zu repräsentieren.
Stephanie Grobs Motivation zu malen ist allerdings nicht die Repräsentation der Dinge, eher würde ich ihr Projekt als Physiologie des Imaginären bezeichnen. Deren wesentlicher Aspekt besteht darin, dass Bilder buchstäblich bildlich unter die Haut gehen. Denn Physiologie, hergeleitet von Physis und Logos, lässt sich mit Heidegger übersetzen als Sprache dessen, was von sich her aufgeht und sich entfaltet.
Wie eine Physiotherapeutin, die sich durch Bereiche von Muskeln und Fasern, die sie benennen und in den Griff bekommen kann, in Regionen des schwer Fassbaren vortastet, in Myofibrillen und Sarkomere, ins Diffizile der Faszien zwischen Epimysium und Perimysium, um ein erstarrtes Gewebe zu beleben, so arbeitet sich Stephanie Grob durch die Anatomie des Vorstellbaren in immer feinere Zwischenräume sinnlicher Wahrnehmungen vor, die im Alltag kaum Beachtung finden, aber im Moment eines unmerklichen Schreckens oder eines schockartig verdrängten Glücks, das zu gross gewesen wäre, um wahr sein zu dürfen, vielleicht erstarrt sind wie Muskeln, um den normalen Lauf der Dinge zu stabilisieren, so dass sie nun brachliegen. Und wie einst die Weberinnen nutzt Stephanie Grob etwa den Blütenkopf einer Wilden Karde, um diese Sensorien zu durchkämmen und neu zu beleben. Dabei lässt die robuste Unscheinbarkeit dieser Pflanze imaginäre Landschaften aus sich hervorwachsen, in denen sich die Künstlerin in immer tiefere Schichten vorwagt.
Auch das umgekehrte Vorgehen ist denkbar. Ausgehend von einer bemalten Leinwand, überklebt sie das Bild mit dünnem Papier, um im nächsten Arbeitsgang daraus Formen und Figuren auszuschneiden, die darunter liegen und nun in einer neuen Umgebung zum Vorschein kommen. So gewinnt sie Raum durch ein Verfahren, das an die Geologie erinnert. Tatsächlich fasziniert sie die Geologie, die Landschaften – die malerische Oberflächengestalt der Erde – freilegt, um in nicht weniger malerische Tiefen des Erdkörpers vorzudringen. Der Körper als tektonisches Gebilde von Bildern, die alle übereinanderliegen, so dass jedes Bild ein anderes unter sich verbirgt und alle aufeinander verweisen: auch das ist eine Technik, Abstand zu den Bildern zu wahren, um sie immer wieder anders zu sehen.
Dazu ein Exkurs: bei meinem letzten Besuch in Stephanies Atelier redeten wir zuerst nicht über das, was uns verbindet, ihre Malerei und meine Schreiberei, sondern ihre Arbeit als Lehrerin. Nicht etwa Zeichnungslehrerin, sondern Klassenlehrerin an einer Basler Schule, in der die überwältigende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler einen sogenannten Migrationshintergrund hat. Dabei schilderte sie Szenen von jugendlicher Gewalt, physischer wie psychischer, aufgeladen durch sexistische, rassistische und nationalistische Vorurteile und eingepfercht in einen Schulbetrieb, dessen Idealvorstellung des selbstgesteuerten Lernens sich von der Realität dieser unbändigen Kräfte immer weiter entfernt, so dass die Lehrerin nicht selten zwischen allen Fronten auf verlorenem Posten steht. Und beim Betrachten ihrer Bilder fällt es nicht schwer, die Turbulenzen, denen sie da standhalten muss, die heftigen Gefühle, die sie in Schranken halten, die aufwühlenden Geschichten, denen sie Gehör schenken muss, in den Grundzügen ihrer Malerei wiederzufinden. Nicht in den Motiven zwar, aber in der Motivation, diese Energien, die sie bändigen und also auf sich nehmen muss, im Atelier dafür zu nutzen, allem Möglichen Raum zu geben, was im gesellschaftlichen Umfeld keinen Platz findet.
Das soll nun aber nicht dazu verleiten, ihre Bilder als Resultat einer unmittelbaren Wirkung solcher Kräfte zu sehen, die von der Künstlerin im Alltag resorbiert, in Bildräume umgeleitet und in eine ästhetische Ordnung gefügt werden. Action Painting ist nicht Stephanie Grobs Sache. Sie sucht nicht Unmittelbarkeit, sondern Abstand. Aber nicht Abstand von den Dingen, die sie bedrängen, im Gegenteil. Sie versucht Distanz zu den Bildern zu wahren, um den Dingen selbst näher zu kommen. Denn die Dinge sind innen. In jenem dunklen Innen, aus dem heraus wir uns von blendenden Bildern umzingelt sehen.
Dazu ein Beispiel. In der letzten Ausstellung von Stephanie Grob fiel mir ein Bild auf, das mir auf den ersten Blick ein Boot zeigte. In weissen Umrissen präsentierte es sich durchsichtig vor einem Hintergrund, den ich als Landschaft empfand: Wasser, Wellen, Wirbel, luftige Spiegelbilder einer nahen Umgebung, dahinter etwas wie Horizont oder Gewölk. Schwer zu sagen, ob der Kahn aus den Wellen ragte oder am Ufer stand, zu sehen war nur der spitze Kiel. Und was mich beschäftigte, sodass ich seither oft den Wunsch hatte, mir das Bild einmal genauer anzusehen, war die Frage, wie ich überhaupt darauf kam, ein Boot zu erkennen. Denn es war nicht nur zu breit, eher Nussschale als Kajak, vor allem sah ich faktisch nur drei geschwungene Pinselstriche, die in einem Punkt zusammenliefen, während die »Bootswände« durchsichtig schienen, wie gesagt. Was ich sah, war eine skizzenhafte Kontur, die an den Bug eines Kahns erinnerte, der freilich auf der Stelle abgesoffen wäre, weil nichts das Wasser davon abhielt, ins Innere zu dringen. Und doch sah ich ein Boot, oder genauer: die Idee eines Boots, die sich vor einem schwer definierbaren Hintergrund abzeichnete. Und indem mein Blick viele Elemente dieses Hintergrunds entsprechend deutete – Ufer, Wirbel, Gebüsch oder Gewölk –, warf die Idee des Boots sozusagen Wellen, die weit über dessen Rand hinaus die ganze Umgebung durchzogen und formten.
Leider können Sie das Bild in dieser Ausstellung nicht sehen, denn es existiert nur in meiner Einbildung. Als ich Stephanie kürzlich bat, mir das Bild wieder zu zeigen, war ich zutiefst irritiert. Denn sie versicherte mir, dass erstens kein anderes Bild existiere, auf das meine Beschreibung passe, und zweitens in jener Ausstellung genau an der Stelle, die ich ihr bezeichnete, eben dieses Bild hing, das sie mir zeigte: ein vollkommen anderes Bild.
Erst nach und nach erkannte ich mein Bild wieder, obschon die Umrisse des »Boots« nicht weiss waren, wie ich gemeint hatte, sondern blau. Dafür hatte ich anstelle des relativ hellen Hintergrunds dunkle Grün-Töne in Erinnerung, wie sie sich in einer andern Serie aus jener Zeit finden. Deren Motiv war der Burgäschisee, den ich gut kenne. Deshalb hatten wir über jene Bilder gesprochen, und später hatten sie sich offenbar nicht nur farblich mit diesem vermischt, sondern auch sprachlich darauf abgefärbt. Denn zum Burgäschisee gehören Boote, die auf jenen Bildern aber fehlten. Dafür glaubte ich in diesem umso deutlicher ein solches zu erkennen.
Unmittelbar nach der Ausstellung sprach ich dann allerdings mit meiner Frau darüber. Dabei zeigte sich, dass sie schon da ein ganz anderes Bild gesehen hatte als ich: kein Boot, eher ein Gefäss, eine gläserne Schale vielleicht. So oder so schien mir aber klar, warum mich das Bild faszinierte. Es zeigte eindrücklich, wie ich fand, was mich damals in meiner eigenen Arbeit beschäftigte: die Rolle der Sprache in der menschlichen, also bewussten Wahrnehmung.
In der Regel haben wir ja den Eindruck, dass wir erstens Dinge, die uns bewusst sind, benennen müssen, um zweitens in Worte fassen zu können, was uns umtreibt. Bei genauem Hinsehen spricht indes vieles dafür, dass die Worte eben dabei jene imaginären Gefässe bilden, die wir Ideen nennen, und die wie jene Förmchen, mit denen Kinder im Sandkasten spielen, bestimmte Dinge erfassen, um sie hervorzubringen. Wenn dem aber so ist, werden uns die Dinge überhaupt nur dadurch bewusst, dass wir sie zur Sprache bringen müssen. Und dabei werden sie ausschliesslich von ihren unscharfen Konturen her erfasst, nämlich aus dem Kontext, in den die Sprache die Sache bettet. Fotografisch gesprochen: die Worte bilden das Negativ der Sache, die wir umschreiben, benennen und besprechen wollen. Erzeugt also die Sprache das Nichts, in dem die Dinge Platz nehmen?
Vor dem Hintergrund dieser Frage sah ich die drei Pinselstriche auf der Leinwand spontan als Hieroglyphe: als ein Sprachzeichen, das »Boot« bedeutete und damit augenblicklich viele Elemente und Aspekte des Bilds assoziativ dieser Deutung unterwarf. Und eben dadurch schien es mir anschaulich zu zeigen, wie Sprache funktioniert, wie wenig es braucht, um den Mechanismus auszulösen, der uns erkennen lässt, was wir zu erkennen glauben.
Nach allem muss ich allerdings zugeben, dass mir das Bild vor allem vor Augen führt, wie mein Blick ihm auf den Leim gegangen ist. Und nun klebt er auf dem Bild, mein Blick, und das Bild zeigt mir mein eigenes Sehen. Genau das tun die Bilder von Stephanie Grob aber systematisch. Denn ihre Physiologie des Imaginären will nicht Vorstellungen als solche zur Darstellung bringen, weder Imaginationen noch Repräsentationen, vielmehr lässt sie das Imaginäre selbst, die Einbildungskraft, von sich aus zum Vorschein und zur Sprache kommen. Technologisch gesprochen: sie ist kein »bildgebendes Verfahren«, eher ein bildnehmendes, das Bilder hervorbringt, um sie uns sogleich wieder zu entziehen, sie sozusagen in ihren eigenen Hintergrund zu rücken. Und indem sie uns nötigen, von allem, was wir auf den ersten Blick sehen, Abstand zu nehmen, verführen diese Bilder zu einer Beschaulichkeit, die in Tiefen führt, auf deren Grund sich das eigene Sehen abzeichnet.
Das Sehen sehen, englisch sightseeing, oder besser, das Sehen schauen: das erinnert mich an eine Sightseeing-Tour, an der ich vor vielen Jahren in London teilnahm. Im zweiten Stock eines Buses ohne Verdeck unterwegs, schauten wir hinab auf den Verkehr, während die Reiseleiterin mit Megaphon die Sehenswürdigkeiten kommentierte, bis eine der Touristinnen ihr zurief: »Regardez, Madame, un anglais!« Mitten im London der Siebziger Jahre hatte die Dame aus der französischen Provinz zu ihrem grössten Erstaunen einen Engländer entdeckt, nämlich einen, wie sie ihn aus den Bilderbüchern ihrer Kindheit kannte, mit Schirm, Crombie Coat und Melone bei einer Ampel am Strassenrand wartend. Sie war entzückt endlich das Bild zu sehen, das ihre Erwartung in vollem Umfang befriedigte. So kann das Sehen zum Gegenteil von Schauen werden. Das Sehen des Sehens aber setzt Irritation voraus.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein beschauliches Sightseeing mit den Bildern von Stephanie Grob, und sollten Sie dabei mein Bild entdecken, werden Sie zurecht den Kopf darüber schütteln, was ich darin gesehen habe – gut so, sehen Sie zu, dass sie besser schauen.